Barrierefreiheit 2025: „Es hilft allen!“ – Experte David Promies im Interview
„Ist Barrierefreiheit nicht eigentlich nur für eine kleine Gruppe relevant?“ Eine Frage, die man oft hört. Doch was, wenn wir Ihnen sagen, dass etwa jeder zwölfte Mann von einer Rot-Grün-Schwäche betroffen ist und gut gestaltete digitale Angebote allen Nutzern zugutekommen? Die digitale Barrierefreiheit wird ab Mitte 2025 (Stichtag 28. Juni!) für viele private Unternehmen zur gesetzlichen Pflicht. Ein guter Grund, genauer hinzusehen.
Wir bei VorSicht kennen uns als Experten für digitale Kommunikation gut mit den Anforderungen und Chancen der Barrierefreiheit aus. Mit diesem Interview möchten wir die wichtigsten Aspekte allgemeinverständlich beleuchten – speziell für Nicht-Fachleute.
Wir sprechen mit David Promies. David ist Webentwickler, konzipiert digitale Anwendungen mit Schwerpunkt Web und ist Experte für Onlineredaktion und Qualitätssicherung – unter anderem im Bereich Barrierefreiheit. Er sagt: „Das Thema ist eigentlich eine sehr lange Geschichte für mich.“ Schon 2003 war er an Projekten beteiligt, die mit dem Biene Award für barrierefreie Websites ausgezeichnet wurden.
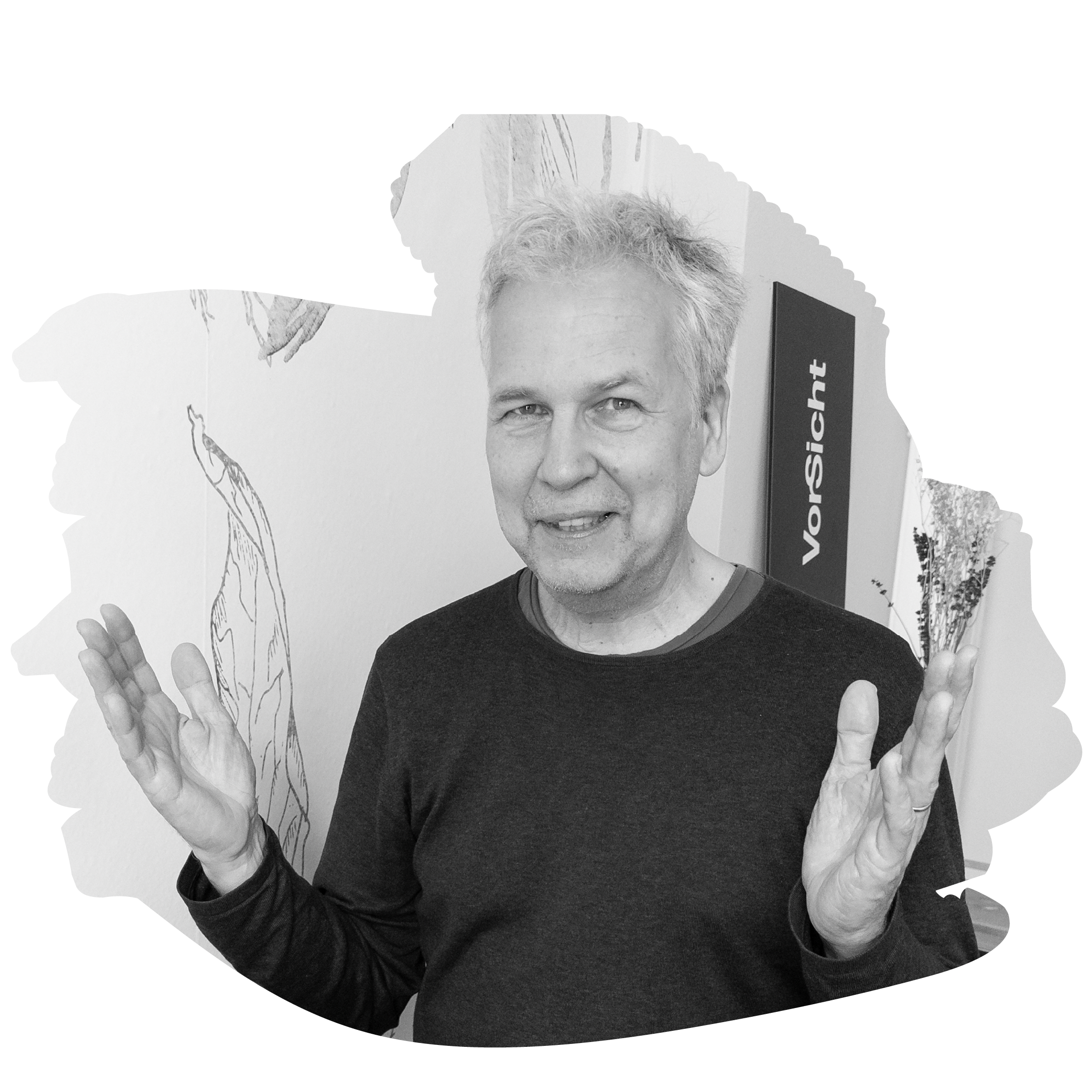
David, wenn wir über Barrierefreiheit im digitalen Raum sprechen, was genau meinst du damit? Viele denken ja an physische Barrieren.
Barrierefreiheit bedeutet ganz allgemein, dass die wichtigen Lebensbereiche für alle Menschen in der gleichen Weise zugänglich und nutzbar sind. Das gilt für Websites und Apps genauso wie für Gebäude. Wenn man es bei der digitalen Barrierefreiheit auf den Punkt bringen möchte, gibt es genau zwei zentrale Anforderungen: Alle Informationen müssen in allen Anwendungsfällen zugänglich sein. Und alle Funktionen müssen nutzbar sein – und zwar unabhängig vom Gerät, also mit Maus, Tastatur oder Touchscreen.
Das Thema ist ja nicht brandneu. Du warst schon früh dabei.
Ja, das Thema begleitet mich schon sehr lange. Das Behindertengleichstellungsgesetz mit den Anforderungen an Zugänglichkeit und Nutzbarkeit kam 2002, gefolgt von der BITV, der Verordnung für barrierefreie Informationstechnologie. Die BITV hat sich ausschließlich an die öffentliche Hand gerichtet. Das wurde auch recht schnell beachtet. Ich habe zum Beispiel mit der VorSicht an barrierefreien Webprojekten für das hessische Sozialministerium gearbeitet, am Familienatlas und am Sozialnetz. Und ein Schülerportal der FH Frankfurt, das ich technisch und grafisch betreut habe, hat 2003 zu den ersten Preisträgern des BIENE Awards der Aktion Mensch gehört. Dann ist das Thema mit dem Aufkommen von Responsive Design und dem Fokus auf mobile Geräte wieder etwas aus dem Blickfeld geraten. Das neue Gesetz, das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), wird dem Thema aber neuen Schwung geben. Denn es richtet sich erstmals an Angebote aus der Wirtschaft.
Wer muss denn jetzt ab 2025 genau handeln?
Betroffen sind die digitalen Angebote privater Unternehmen, die sich an Verbraucher richten und zum Abschluss eines Verbrauchervertrages führen können. Gemeint sind also alle Angebote, wo etwas gekauft, gebucht oder reserviert werden kann. Auch Kontaktformulare für Bestellungen oder zur Geschäftsanbahnung fallen darunter. Diese Angebote müssen zukünftig barrierefrei sein.
Gibt es Ausnahmen von dieser Pflicht?
Ja, für Kleinunternehmen. Aber hier müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: die Unternehmen müssen weniger als 10 Angestellte und einen Jahresumsatz von maximal 2 Mio. Euro haben. Wichtig ist, dass beide Kriterien zutreffen. Sonst greift die Ausnahmeregel nicht.
Und was passiert, wenn man sich nicht daran hält?
Die Bundesländer wollen eine gemeinsame Marktüberwachungsstelle gründen, die sich um die Einhaltung des BFSG kümmern soll. Diese Behörde wird mit Stichproben versuchen, nicht barrierefreie Angebote zu erfassen. Man kann sich aber auch als Verbraucher oder Verbraucherin direkt mit Beschwerden an die Behörde wenden. Wenn das betroffene Unternehmen trotz Aufforderung weiter untätig bleibt, kann es ein Bußgeld geben. Als letztes Mittel steht dann die Einstellung des Angebots im Raum.
Was sollten Unternehmen jetzt konkret tun?
Zuerst muss man sich fragen: Bin ich wirklich vom BFSG betroffen? Das zu entscheiden kann im Einzelfall schwierig sein. Wer zählt alles zu den für das Gesetz relevanten Mitarbeitern? Enthält meine Website Elemente, die zur Kategorie „Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr“ gehören? Wenn das nicht so eindeutig ist, hilft dann eventuell ein Anwalt. Liegt eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit vor, sollte die bestehende Website ausführlich getestet werden.
Wie geht das Testen dann praktisch vor sich?
Man identifiziert 3-4 Seiten im Auftritt, die für den konkreten Geschäftsvorgang relevant sind. Normalerweise sind das die Startseite, eine Übersichtsseite, eine Detailseite und eine Formularseite. Für eine erste, ganz grobe Einschätzung kann man ein automatisiertes Testtool verwenden. Aber der eigentliche Test dieser Seiten muss manuell erfolgen. Getestet wird nach der EU-Norm zur digitalen Barrierefreiheit, die sich wiederum an den WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) orientiert. Das ist ein weltweiter Standard mit praxisnahen Prüfschritten. Für das mittlere Prüflevel AA durchlaufen die Seiten 57 Prüfschritte, die zum Teil recht aufwändige Testabläufe haben. Die Seiteninhalte und Funktionen müssen zum Beispiel komplett mit einer Vorlesesoftware, einem Screenreader getestet werden.

Welche Barrieren kann denn eine normale Website haben?
Im Kern ist jede Website erst einmal barrierefrei, denn der HTML-Code, aus dem alle Webseiten bestehen, bringt alles dafür mit. Dieser Code liefert für jedes Element auf der Seite eine Zusatzinformation, die mir mitteilt, um was für ein Element es sich gerade handelt. Ist es eine Überschrift, ein Absatz, eine Liste, ein Button? Diese Informationen sind gerade für blinde Menschen, die einen Screenreader nutzen, essenziell wichtig.
Probleme kommen dann, wenn diese Standardelemente nicht korrekt verwendet werden. Wenn zum Beispiel Überschriften nicht in der richtigen Reihenfolge stehen. Oder wenn Bilder keine Beschreibungen haben.
Das klingt, als wäre die Redaktion hier besonders gefordert.
Das ist tatsächlich Redaktionsarbeit. Oft mangelt es hier am Know-how, deshalb empfehlen wir Schulungen und einen entsprechenden Know-how-Transfer. Ein Styleguide für Barrierefreiheit kann auch sehr helfen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass die eingesetzten Redaktionssysteme auch die technischen Möglichkeiten für diese redaktionellen Eingriffe bieten. Nach meiner Erfahrung ist die Unterstützung oft nicht ausreichend, gerade was die Verbindung von inhaltlicher Gliederung und Gestaltung angeht.
Wie sieht es mit WordPress aus? Viele Unternehmen nutzen das ja.
Es gibt WordPress-Themes, die sind recht gut darauf vorbereitet, zum Beispiel das Genesis-Framework oder die Astra-Themes. Dort sind viele Aspekte berücksichtigt, die für eine Tastaturnutzung oder für Screenreader wichtig sind. Ein Pluspunkt ist auch, wenn ein Theme den neuen Texteditor von WordPress verwendet. Mit diesem Editor lassen sich die Headline-Strukturen korrekt einstellen, und auch die Eingabe von Bildbeschreibungen ist kein Problem. Nicht so gut sieht es bei den Plugins aus, ohne die ja keine WordPress-Seite auskommt, wenn sie interaktive Elemente oder Formulare einsetzen will. Viele Plugin-Entwickler:innen achten hier noch nicht genug auf Barrierefreiheit. Und auch bei der Plugin-Auswahl hat dieser Aspekt bislang noch zu wenig Gewicht.
Gibt es Einschränkungen im Design durch barrierefreie Umsetzungen? Ich denke da an Farbkontraste.
Ja, das kann ein Punkt sein, an dem man zu Kompromissen bereit sein muss – je nach grafischem Anspruch. Die WCAG machen hier klare Vorgaben. Wenn es nicht gerade um Logos geht, hat die Lesbarkeit von Texten und die Erkennbarkeit von Buttons und Icons immer Vorrang vor dem Corporate Design. Will man trotzdem keine Abstriche bei der Farbgestaltung machen, bleibt als letztes Mittel noch eine Schalterlösung auf der Seite, mit der man bei Bedarf eine kontrastreichere Darstellung aktivieren kann. Das ist zulässig, aber der Schalter selbst muss auch barrierefrei sein.
Wie ist es mit interaktiven Elementen? Sollte man auf Slider, Aufklapper und aufwändige Formulare besser verzichten?
Nein, die können auf jeden Fall verwendet werden – wenn man darauf achtet, dass sie auch per Tastatur und Screenreader nutzbar sind. Da gibt es oft Probleme, besonders dann, wenn man mit fertigen Lösungen arbeitet. Das gilt auch für Formulare. Eingabefelder sind zwar für Screenreader im Normalfall gut erkennbar, aber Fehlermeldungen sind es in vielen Fällen nicht. In diesem Bereich ist der HTML-Code um einige sinnvolle Attribute erweitert worden, die sehr gut dazu beitragen, Fehlermeldungen für blinde Menschen identifizierbar zu machen. Diese Attribute werden aber leider oft nicht eingesetzt.
Ein großer Bereich sind Videos. Was ist da zu beachten?
Hier sind die Vorgaben nicht ohne. Je nach Art des Videos muss es eine zusätzliche Textbeschreibung, eine zusätzliche Audiospur mit einer gesprochenen Beschreibung oder Untertitel geben. Die Erstellung dieser Inhalte ist aufwändig. YouTube erstellt zwar automatisch Untertitel, aber ohne Nachbearbeitung geht es meist nicht. Und den Einbau dieser Elemente kann ein Redaktionssystem oft nicht so einfach leisten.
Stichwort Kosten. Ist Barrierefreiheit ein großer Kostenfaktor?
Das lässt sich pauschal schwer beantworten. Klar ist auf jeden Fall, dass die Integration von Barrierefreiheit schon bei der Neuentwicklung einer Website deutlich günstiger ist als nachträgliche Anpassungen. Wie hoch die Kosten letztlich sind, hängt dann vom verwendeten Redaktionssystem und den Plugins ab. Im Detail können Anpassungen auch mit vertretbarem Aufwand gemacht werden. Mir ist es aber wichtig, dass man dieses Thema nicht nur unter dem Aspekt der Belastung sieht. Es ist wie beim Kampf gegen den Klimawandel: Hier geht es nicht um Zwangsmaßnahmen, sondern um eine sinnvolle Veränderung, die letztlich allen Menschen zugutekommt. Barrierefreiheit sorgt für gut benutzbare Websites, und das ist ein echtes Qualitätsmerkmal, das sich für kommerzielle Anbieter auch bezahlt machen wird.
Eine letzte Frage: Bekommt man für eine barrierefreie Seite ein Zertifikat?
Ein offizielles Zertifikat gibt es nicht. Auf jeder barrierefreien Website sollte es aber eine Erklärung zur Barrierefreiheit geben. Dort kann man nachlesen, nach welchen Kriterien geprüft wurde, wer den Test durchgeführt hat und wie das Ergebnis ausgefallen ist. Wenn es Dinge gibt, die verbessert werden können, sollten die hier auch erscheinen.
David, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch und die klaren Worte!
Schlussfolgerung & Ausblick
Das Gespräch mit David Promies hat gezeigt: Digitale Barrierefreiheit ist kein Hexenwerk, aber ein Thema, das Aufmerksamkeit und Expertise erfordert. Es geht darum, digitale Angebote so zu gestalten, dass sie von möglichst vielen Menschen, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten oder Einschränkungen, genutzt werden können. Das ist nicht nur eine Frage der Fairness und bald auch der gesetzlichen Notwendigkeit, sondern, wie David betont, ein echtes Qualitätsmerkmal.
Ihr nächster Schritt: Den Status Quo prüfen
Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie es um die Barrierefreiheit Ihrer eigenen digitalen Angebote bestellt ist? Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir von VorSicht eine spezielle Landingpage zum Thema Barrierefreiheits-Check eingerichtet.
Dort finden Sie:
Unseren kostenlosen Selbstcheck: Ein erster schneller Test, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo Ihre Website oder App aktuell steht und welche Bereiche möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern.
Den ausführlichen Profi-Check: Wenn Sie eine detaillierte Analyse wünschen, bieten wir gemeinsam mit unserem Experten David Promies einen umfassenden Barrierefreiheits-Check an. Sie erhalten nicht nur eine Bewertung nach den offiziellen Kriterien (WCAG 2.2), sondern auch konkrete, priorisierte Handlungsanweisungen und Beispiele, wie Sie die Barrierefreiheit Ihres Angebots gezielt verbessern können.





